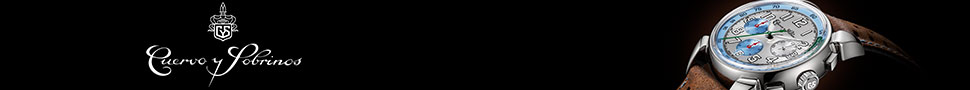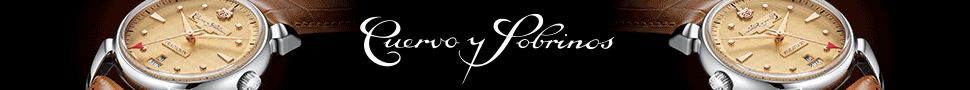Die Uhrenindustrie verkauft immer weniger Uhren und gerät immer mehr in Schräglage. Schuld daran sind nicht die schlechten wirtschaftlichen Parameter, sondern es sind mangelnde Innovationen und unfähige CEO’s, die dies zu verantworten haben.
Seit bald einem Jahrzehnt verzeichnet die Schweizer Uhrenindustrie – weiterhin das Epizentrum der Luxusuhrenherstellung – einen starken Rückgang der Verkaufszahlen, doch es scheint niemanden zu interessieren.
Laut dem Verband der Schweizer Uhrenindustrie sind die Exporte seit 2015 von 28,1 Millionen Stück pro Jahr auf 16,9 Millionen im vergangen Jahr eingebrochen, wobei die Zahlen mit Vorsicht zu geniessen sind, da der Verband der Schweizer Uhrenindustrie nur die Interessen ihrer eigenen Mitglieder vertritt.
Auf meinen Reisen durch die Chefetagen dieser Uhrenwelt in den letzten 24 Monaten bin ich nicht vielen CEO’s begegnet, die bereit waren, Klartext zu sprechen: “Die Uhrenindustrie befindet sich in einer tiefen Rezession-Phase”. Umso unglaubwürdig die Antwort vieler Chefs.
Wie kann das sein, frage ich mich, während der rasanten Stückzahlenrückgang anhält: Der Verband verzeichnet in diesem Jahr einen weiteren Schwund um zehn Prozent, wobei der Trend im August und September beschleunigt hat. Setzt sich die Abwärtsspirale fort, landet man bis zum Jahresende bei 15 Millionen. Doch auch die Zahl täuscht: Denn von dieser muss man zusätzlich die weltweit äussert erfolgreiche MoonSwatch-Kooperation von Swatch und Omega unter dem Dach der Swatch Group abziehen, die schätzungsweise zwischen einer und zwei Millionen Einheiten pro Jahr ausmacht. In Summe haben sich damit die Exportmengen in nur einem Jahrzehnt mehr als halbiert.
Wo sind bloss all die Uhrenkäufer hin? Die Antwort scheint sich die Branche bisher nur widerwillig zu srellen. Denn abgesehen von der sehr erfolgreichen Kollaboration von Swatch und Omega mit 275-Euro-Uhren und der fast ebenso erschwinglichen Tissot PRX wurden kaum Versuche unternommen, den Niedergang zu bekämpfen. Der findet nämlich grösstenteils in genau dieser mittleren Preisklasse bis 5000 Euro statt.
Durchschnittspreis ist explodiert
Es gibt offensichtlich für etliche CEO’s scheinbar gute Gründe, nichts zu tun: Die zahlenmässige Rezession wird nämlich durch explodierende Exportwerte verschleiert: In derselben Zeitspanne sind die Durchschnittspreise für eine Schweizer Uhr in die Höhe geschossen: Lag er 2025 noch bei rund 720 Schweizer Franken, waren es 2023 schon 1510.
Schaut man genau hin, ist es kein Zufall, dass der Einbruch des Volumens der traditionellen Uhrenindustrie mit der Markteinführung der Apple Watch im Jahr 2015 (sie wurde bereits im September 2014 vorgestellt). Anstatt mehr Energie in ein Segment zu stecken, das mit zunehmender Nachfrage nach hoch entwickelten Smartwatches einbrach, haben die meisten Marken daher vor allem die Preise erhöht, um dieser Konkurrenz zu entgehen.
Die Apple Smartwatches kosten interessanterweise zwischen 250 und – als Hermès-Variante – 1580 Euro. Nach anfänglichen, eher halbherzigen Versuchen, selbst Smartwatches herzustellen, wählten Schweizer Hersteller den Weg, Uhren im unteren Preissegment gleich gänzlich zu streichen. Die Nachfrageblase der Pandemie hat diesen Effekt natürlich befeuert. Teuer verkaufte sich. Bislang.
Schwund der Massenmarken
Die Frage, ob dieser Niedergang der Stückzahlen für Uhrenhersteller von Bedeutung ist, hängt vom jeweiligen Standpunkt ab. Im Oktober nahm ich am Horology Forum der Dubai Watch Week in Hongkong teil, einer vom Einzelhändler Ahmed Seddiqi & Sons konzipierten Plattform für Diskussionen über die Lage der Uhrenindustrie. Ich moderierte eine Podiumsdiskussion mit einem Sammler, der die Zukunft der Branche als „exklusiver“ bezeichnete. Er prognostozierte: Massenmarken würden verschwinden, während kleinere, höherwertige Hersteller aus dem Schatten treten würden, denn die sprächen die Sammler an.
Der Gründer einer dieser unabhängigen High-End-Unternehmen bestätigte mir das noch am selben Tag: Das Geschäft laufe gut. Der Name des Unternehmens: Ressence. Die Manufaktur stellt 750 Uhren pro Jahr her.
Doch was ist mit den Massenherstellern, die industriell Hunderttausende von perfekten, eher unspektakulären mechanischen Uhren herstellen? Marken, die man im Vergleich dazu als erschwinglich oder inclusive bezeichnen könnte?
Für sie ist die Zukunft ungewiss. Denn es gibt seit Jahren keinerlei Anzeichen für eine Stabilisierung, geschweige denn für eine Rückkehr zum Stückzahlenwachstum. Auch wenn in der Debatte, ob dieser Trend überhaupt umgekehrt werden sollte, die Meinungen auseinandergehen, sind Lösungsansätze leichter zu finden, als mancher denkt.
Denn während die Exportvolumina schrumpfen, gibt es Marken, die sich behaupten. Darunter sind sehr große Namen: Cartier zum Beispiel hat die aktuellen Schwierigkeiten der Branche elegant umgangen (der Dachkonzern Richemont berichtet nicht detailliert nach Tochtergesellschaften). Wie? Indem man sich ausgerechnet von mechanischen Erfindungen abgewandt hat. Stattdessen setzt man auf stilvoll geformte Uhrenklassiker wie die Santos, die Panthère oder die ikonische Tank. Viele Modelle davon werden von batteriebetriebenen Quarzwerken angetrieben und kosten Tausende Euro weniger als die gleichen Modelle mit mechanischem Uhrwerk.
Im Top-Preissegment sind die Zahlen von Audemars Piguet in die Höhe geschossen und haben das Familienunternehmen am Rivalen Patek Philippe vorbeiziehen lassen, ohne dass man seine Produktpalette wesentlich geändert hätte, dafür aber die Kommunikationsstrategie. Hochkarätige Kooperationen mit Koryphäen des Zeitgeistes von Jay-Z bis Travis Scott und von Serena Williams bis zum Marvel-Universum haben der Manufaktur erstaunliche Ergebnisse beschert: Unter dem vorherigen Geschäftsführer François-Henry Bennahmias verdreifachte sich der Umsatz innerhalb eines Jahrzehnts bis 2023 auf 2,35 Milliarden Schweizer Franken. Am anderen Ende des Marktes macht eine neue Mikromarkenkultur gegenüber den Etablierten Boden gut. Baltic, Studio Underdog, Furlan Marri und die in diesem Jahr neu eingeführten Anoma und Alterum steigen in den Ring um das mittlere Preissegment.
Dagegen sind die Preise für TAG-Heuer-, Omega- und Breitling-Uhren heute deutlich höher als vor der Einführung der Apple Watch. Wahrscheinlich wird aber keine der neuen Marken die millionenfachen Stückzahlenlöcher stopfen können. Die Erfolgsgeschichten weisen jedoch Ähnlichkeiten auf: Diese Firmen verbinden starke Markengeschichten mit auffallendem Design und einem guten Preis-Leistungs-Verhältnis. Anders gesagt: Die Kunden kaufen weiter, wenn die Story bewegt, das Design überzeugt und sie sich nicht über den Tisch gezogen fühlen.
Rolex macht es vor
Keine Marke bringt diese Eigenschaften besser auf den Punkt als Rolex. Analysten zufolge machen die Genfer, die als Stiftung firmieren und nicht berichten, ein Drittel des Schweizer Uhrenmarktes aus mit einen Jahresumsatz von etwa zehn Milliarden Schweizer Franken. Rolex wird aber auch deshalb relativ gelassen durch den Sturm segeln, weil das Unternehmen seit jeher alle diese Kaufargumente beachtet und frei Haus mit jeder der rund 1,2 Millionen Uhren jährlich liefert.
Ich habe mir diese Argumente nicht ausgedacht. In der jährlichen Uhrenumfrage von Deloitte werden seit Jahren regelmäßig Marke, Design und Preis-Leistungs-Verhältnis als die drei wichtigsten Faktoren für die Kaufentscheidung von Uhrenkäufern ermittelt. Gleicht man diese Argumente mit den leistungsstärksten Herstellern der Industrie ab, wird auch schnell klar, warum diese so erfolgreich sind.
Wer nach Krisen Ausschau hält, wird sie in der Regel auch finden, aber die Luxusuhrenindustrie scheint am Scheideweg zu stehen. Es bleibt zu hoffen, dass die Schweizer Uhrenindustrie weiterhin diesen Namen verdient, damit mechanische Uhren nicht nur für eine superreiche Minderheit erschwinglich bleiben.
Unfähige CEO’s
Aufgrund meiner über 50 jährigen Erfahrung in und mit der Uhrenindustrie verwechseln die CEO’s eines: Sie haben Produkte zu verkaufen und nicht sich selbst.
Mangelnde Innovationskraft
eine Armbanduhr war die letzten vom 19. Jahrhundert bis heute immer rund oder eckig und besass ein automatisches, ein Handaufzugswerk oder ein Quarzwerk. Ende der Fahnenstange.
Marktbereinigung
Es gibt viel zu viele austauschbare Uhren, das wird eine Marktbereinigung respektive Marktkonzentration mit sich ziehen.
SUMMARY_
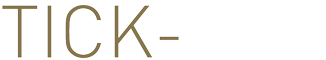 Tick-Talk TickTalk Blog
Tick-Talk TickTalk Blog